Der Weg zum Grab, um zu verzeihen

Eine Familienidylle, die täuscht. (Foto: privat)
Was wird aus den Menschen, die als Kinder vom Jugendamt aus ihrer Familie geholt wurden? Jonas hat am eigenen Leib Misshandlung erfahren und versucht trotz dieser Erfahrungen einen anderen Weg zu gehen. Eine Geschichte über das Schicksal.
Erzbistum Paderborn. Wenn Jonas an die schönen Momente aus seiner Kindheit denkt, ist es, als würde er durch ein Milchglasfenster schauen. Sie sind zwar da, aber blass. Aus seiner Jeanstasche kramt er ein Handy hervor und zeigt Fotos, die in seinem Elternhaus aufgenommen wurden. Auf einem der Bilder sitzt er an einem Tisch, malt mit einem hellblauen Stift etwas auf ein weißes Blatt Papier. Der blonde Junge lächelt in die Kamera. Im Hintergrund steht ein Vogelkäfig und ein Haus aus Duplo-Bausteinen thront auf einem Wäschekorb. Doch die Bilder, die nach einer Familienidylle aussehen, täuschen. Während seiner Kindheit wurde Jonas misshandelt.
Als er 13 Jahre alt war, holte ihn das Jugendamt aus der Familie und er wuchs in einem Internat auf. Heute ist Jonas 24 Jahre alt, hat eine abgeschlossene Ausbildung in der Tasche und zählt zu den „Careleavern“. Das sind Menschen, die die Jugendhilfe verlassen haben. Doch seine Kindheit hat ihn geprägt. Er ist einer von vielen, die nicht die gleichen Voraussetzungen für das Leben hatten wie die Kinder, die in einem stabilen Elternhaus aufgewachsen sind. Welche Chancen haben diese Menschen?
Careleaver – In der Gesellschaft werden sie übersehen, trotzdem gibt es sie.
Rund 210 000 junge Menschen wuchsen 2021 laut dem Statistischen Bundesamt in Heimen oder Pflegefamilien auf. Nach dem 18. Lebensjahr müssen sie selbst die Anträge auf Begleitung stellen, ansonsten ist niemand mehr zuständig. Wenige studieren, einige machen eine Ausbildung, manche stürzen ab, beziehen Bürgergeld, gehen in die Obdachlosigkeit oder die Drogenszene.
Die Fälle von Kindeswohlgefährdung sind auf dem Höchststand, die Kapazitäten am Limit. Die JAEL-Studie der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel und des Universitätsklinikums Ulm hat über 500 Kinder und Jugendliche aus sozialpädagogischen Institutionen befragt. Die Ergebnisse zeigen auf: Diese Kinder sind nicht nur häufiger von psychosozialen Belastungen und traumatischen Erfahrungen betroffen – sie neigen auch eher zu gewalttätigem Verhalten. Andere Studien belegen, sie haben zudem schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, weibliche „Careleaver“ werden häufiger ungeplant schwanger. In der Gesellschaft werden sie übersehen, trotzdem gibt es sie.

In einem Café in Gütersloh sitzt Jonas. Er zählt zu den „Careleavern“, hat einen festen Job. Eigentlich hat er es geschafft. Doch um darüber zu reden, welche Chancen Menschen mit einem Hintergrund wie er selbst haben, muss man ganz am Anfang beginnen.
Keine guten Erinnerungen an die eigene Kindheit
Rückblick: An seine Kindheit hat Jonas keine guten Erinnerungen. Seine Mutter war Alkoholikerin, hat ihn misshandelt, sein Vater war nie da. Es fing an mit Schlägen, Beleidigungen, gefolgt von Nötigungen. „Ich durfte nicht auf Toilette gehen, mein Zimmer wurde zugeschlossen. Ich durfte nichts, ohne dass ich nach Erlaubnis gefragt habe.“ Wenn Jonas redet, spricht er klar und reflektiert. Man sieht ihm an: Es ist ein ernstes Thema, eines, das ihm nahe geht, doch mittlerweile kann er gefasst damit umgehen. Jonas möchte offen über das Thema Kindesmisshandlung reden, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
Während der Schulzeit wurde er gemobbt. Er war anders, der „ADSler“. Wenn er sich gemeldet hat, dann sehr energisch. Kam er nicht dran, zeigte er sich stark enttäuscht. Einmal äußerte er Selbstmordgedanken, erzählt er. In einer psychiatrischen Einrichtung wurde dann festgestellt: Jonas ist gar nicht suizidal. „Weil ich da aus meinem gefährdeten Raum raus war“, sagt er. „Stattdessen haben sie gesagt, dass ich ADS habe. Die kannten die Umstände bei mir zu Hause und haben nicht hinterfragt, warum ich das gesagt habe. Die haben nichts gemacht.“ Wenn er diese Sätze sagt, klingt es vorwurfsvoll. Als fühlte er sich im Stich gelassen.
Umgang mit Suizidgedanken
Beate Wieberneit ist Psychologin und arbeitet seit 2011 im „Bonny 5“, einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Paderborn. Sie spricht viel mit den Bewohnern, weiß, was sie beschäftigt. „Geäußerte Suizidgedanken sollte man immer ernst nehmen“, sagt sie. Es könne durchaus auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit sein, aber „wenn jemand zehn Mal sagt: ‚Ich bringe mich um‘, kann es sein, dass irgendwann doch ein Impuls durchkommt“. Schließlich verändern sich mentale Zustände auch.
Gerade Kinder, die keine sichere Bindung zu verlässlichen und feinfühligen Eltern haben, neigen eher dazu, psychische Störungen zu entwickeln. Die ersten sechs Jahre beschreibt Wieberneit als sehr wichtig für die Entwicklung von Bindung. Erwachsene seien für Kinder überlebenswichtig. Defizite können also extreme Ängste auslösen. Bindungsstörung ist ein Stichwort, das immer wieder vorkommt.
Mit zehn Jahren sprach Jonas das erste Mal mit einer Sozialarbeiterin an seiner Schule darüber, dass er zu Hause misshandelt wird. Sie habe daraufhin das Jugendamt eingeschaltet. Gemeinsam haben sie alles versucht: Verhaltenstherapie, Familientherapie, Erziehungstherapie. „Meiner Mutter fiel es schwer, sich zu ändern“, erzählt Jonas. „Sie hätte sich dafür ihre Schuld erst eingestehen müssen. Das war nie der Fall.“
Wieso hat niemand eingegriffen?
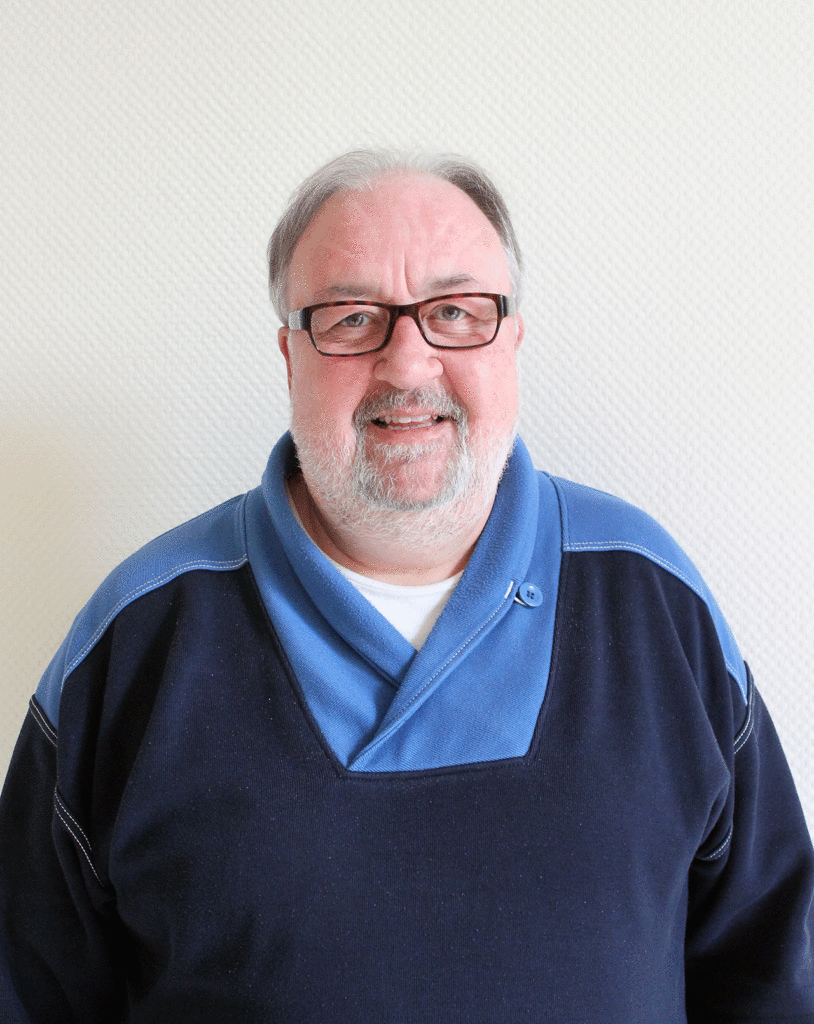
An diesem Punkt drängt sich eine Frage auf: Wieso musste sich Jonas als zehnjähriges Kind selbstständig an eine Sozialarbeiterin wenden? Wieso hat keiner vorher etwas unternommen? „Solche Familien sind unglaublich geschickt darin, Missstände zu kaschieren“, erklärt Thomas Reelsen. Er ist der pädagogische Leiter und stellvertretende Einrichtungsleiter im „Bonny 5“. Familien, in denen Missstände vorkommen, instrumentalisieren häufig die Kinder, nichts zu verraten und sich an niemanden zu wenden, erklärt der Mann mit dem freundlichen Gesicht und jahrelanger Erfahrung. „Alarmzeichen sind plötzliche Veränderungen im Verhalten“, sagt Reelsen. „Kinder werden sich wahrscheinlich erst an jemand anderen wenden, wenn der Druck so groß ist, dass man es nicht mehr aushält.“
Das Gefühl, nicht gewollt zu sein
Jonas’ Eltern haben ihm das Gefühl gegeben, ihn nicht zu wollen. Er sagt, das empfinde er bis heute so. Doch anstatt ihn direkt wegzugeben, als sie die Möglichkeit hatten, behielten sie ihn da. Vielleicht wollten sie sich ihre Fehler nicht eingestehen, was sie dadurch getan hätten. Vielleicht hätten sie so weiterhin die Fehler bei ihm suchen können. Vielleicht war es das Ego. Am Ende weiß das niemand.
Sein Auszug verlief schließlich auf der „linken Spur Autobahn“; alles ging sehr schnell. Die letzte Nacht zu Hause hörte er, wie seine Mutter weinte. Jonas sagt: „Ich dachte wirklich: Vielleicht ist das der Wendepunkt, an dem meine Mutter merkt, dass sie sich ändern muss. Das war aber nicht so.“ Seit er zwölf ist, schreibt Jonas Raptexte über seine Vergangenheit. Mit seinen Texten möchte er Gleichgesinnte ansprechen und auch über sich erzählen. In einem seiner Texte fragt er: „Sei bitte einmal ehrlich, hast du mich je geliebt?“

Psychologin Wieberneit spricht davon, dass gerade jüngere Kinder oft wenig Selbstwert hätten und sich selbst dafür verantwortlich machten, was passiert ist. Sie sagt auch, dass die emotionale Belastung oft zu Konzentrations- oder Schlafproblemen führt. „Das Emotionale blockiert im Kopf so stark, dass es schwierig wird, schulische Leistungen zu erbringen.“ Reelsen sagt, dass die wenigsten Abitur machen. „Es ist erst mal unser Ziel, in ein festes Gefüge zu kommen und jemand auf die eigenen Füße zu stellen“, erklärt er. Umso später Jugendliche zu ihnen kämen, desto schwieriger sei es jedoch, deren Vergangenheit aufzuarbeiten.
Perspektivlosigkeit
In einem Jugenddorf in Warburg arbeitet Vivian B. an der Förderschule. Seit sechs Jahren ist sie in der stationären Jugendhilfe tätig. Sie spricht von einer Perspektivlosigkeit, die manche der Jugendlichen haben. „Man kann nicht alle retten“, sagt sie. Ein Satz, den auch Reelsen bereits äußerte. „Manche haben so unverarbeitete Traumata, ein unfassbares Leiden. Diese Aspekte zusammengebündelt, geben ein großes Risiko, dass sie einen negativen Weg für ihr Leben wählen“, erklärt Vivian B. Wo gehen diese Menschen dann hin? „Vielleicht in die Obdachlosigkeit, zu anderen Menschen, die kein festes Zuhause mehr haben“, sagt die Sozialarbeiterin. Manche beziehen Bürgergeld.
Hin und wieder kommt es vor, dass Jugendliche aufgrund ihres Verhaltens ständig ihren Wohnort wechseln, von Einrichtung zu Einrichtung durchgereicht werden. Wieberneit spricht davon, dass dies ein Ausdruck des Bindungsverhaltens in dem Menschen selbst sei. „Diese Jugendlichen tun oft alles dafür, dass solche Maßnahmen wieder beendet werden.“ Wird das gestörte Bindungsverhalten durch den Rauswurf nicht bestärkt? „Eigentlich schon.“ Rauswerfen klinge immer sehr hart, sagt Wieberneit. „Wenn ein Kind in eine Gruppe kommt und alle anderen Angst bekommen, dann hat man eigentlich keine andere Chance, als woanders zu schauen, ob es besser passt.“
Jeder hat sein Leben auch selbst in der Hand
Welche Auswirkungen hat die Kindheit auf das restliche Leben? Inwieweit ist das Leben vorherbestimmt, wenn Kinder in ihren ersten Jahren Traumata erleben mussten? Es sind Fragen danach, wer am Ende über das Leben bestimmt und wie man mit seinen Erfahrungen umgeht.
Wieberneit sagt: „Auch wenn das Kinder und Jugendliche sind, hat jeder sein Leben ein Stück weit selbst in der Hand.“ Die Hilfen werden angeboten und sie werden angenommen, wenn es der richtige Zeitpunkt für die Person ist. Erzwingen lässt sich nichts. Grundsätzlich würden Kinder mit ihren Erlebnissen ganz anders umgehen als Erwachsene, erklärt die Psychologin. Sie sehen das erst mal als normal an. „Ich habe hier schon oft kleine Mädchen gehabt, die zu ihren Vergewaltigern zurückwollten. Kinder, die körperlich und psychisch misshandelt wurden und trotzdem wieder nach Hause wollten.“
Verdrängung von Traumata
Auch Verdrängung ist ein Thema. Vivian B. berichtet von einem Fall, der sie bis heute beschäftigt. Sie erzählt von einem Jungen, der seitens des Vaters so massive Gewalt erfahren hat, dass er an die Heizung gekettet und richtig blutig geschlagen wurde. Davon gab es ein Foto. „Im Prozess der Traumaverarbeitung wurde er irgendwann mit diesem Bild konfrontiert“, sagt die Sozialpädagogin. „Sein Gehirn hatte das so abgespalten, dass er dachte, das sei sein Bruder. Dabei hatte er nie einen Bruder.“ Psychologin Wieberneit erklärt dies als Schutzmechanismus.

Jonas leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Seine Erfahrungen aus der Kindheit beschäftigen ihn bis heute. Noch immer kann er nicht im Dunkeln schlafen, Weihnachten nennt er „das schlimmste Fest des Jahres“. Doch auch wenn er als Kind nicht in ein Internat wollte, sagt er heute, das war das Beste, was das Jugendamt für ihn hätte tun können. Auf seinem linken Unterschenkel trägt er ein Tattoo, das eine Uhr darstellt, dessen Zeiger die Zeit fünf vor zwölf anzeigen. Mehrere Raben steigen aus ihr heraus und fliegen nach oben. „Fünf vor zwölf war die Uhrzeit, als das Jugendamt mich rausgeholt hat“, sagt Jonas. Die Raben sollen die Freiheit symbolisieren.
Vorurteile gegenüber der Jugendhilfe
Reelsen ist überzeugt, es sei wichtig, den Kindern das Gefühl zu geben, sie nicht fallen zu lassen und für sie da zu sein – auch wenn sie sich unangemessen verhalten. Viele haben jedoch Vorurteile gegenüber Einrichtungen der Jugendhilfe. „Im Wort Kinderheim steckt eine Assoziation drin“, sagt der pädagogische Leiter. „Es gibt immer noch welche, die nach Schlafsälen oder einem Essenssaal fragen und die dann überrascht sind, dass jeder sein eigenes Zimmer hat.“ Diese Bilder würden manchmal durch die Medien transportiert, kritisiert er. Doch auch wenn die Jugendhilfe wichtig ist und besser als ihr Ruf – es gibt zu wenig Plätze. „Wir haben ein Problem mit Fachkräftemangel“, so Reelsen. Auch Vivian B. berichtet davon, dass sie oft absagen müssen, weil es keinen Platz gibt. „Daraus resultiert, dass die Kinder, die aus der Familie rausmüssen, nicht aus der Familie rausgenommen werden können“, erklärt sie, „weil es keine Unterbringungsmöglichkeiten gibt.“
Das Internat, in dem Jonas aufgewachsen ist, liegt in der Nähe von Heidelberg. Das Ziel war die Rückführung in die Familie auf langfristige Sicht. Doch seine Eltern kooperierten nicht, also blieb er da. Danach lebte er in einer Außen-WG, machte eine Ausbildung und zog nach Harsewinkel – ein Ort in der Nähe von Gütersloh – um bei Arvato im Kundenservice zu arbeiten. Jonas sagt, er wollte seine Vergangenheit hinter sich lassen.
Der eigene Name – eine Akte
„Als ich in das Internat gekommen bin, war das am Anfang ein Start bei Null. Doch ab dem Moment war mein Name eine Akte, die immer weitergereicht wurde“, erzählt er. Egal, in welche Gruppe oder Ausbildung er ging – die kannten ihn, bevor er sie kannte. Dies hat Vorteile: Sie wissen, mit wem sie es zu tun haben und wie sie mit ihm umgehen sollen. Jonas sagt aber auch: „Du kannst dich nicht als der entfalten, der du bist, weil durch deine Akte die Vergangenheit immer präsent ist.“ Beim Umzug hatte Jonas Hilfe, danach hat er sich alles selbst erarbeitet. Unterstützung erfährt er viel in seinem Umfeld. Fällt die Familie weg, gewinnen Freunde und Arbeitskollegen an Bedeutung.
2020 zeigte er seine Eltern an. „Meine Mutter wurde in U-Haft genommen“, erzählt der 24-Jährige. Auf den Tag genau ein Jahr darauf starb sie an Herzversagen. Sein Vater machte ihn verantwortlich. Jonas sagt über seine Mutter: „Wer in der Lage ist, sein Kind zu misshandeln, der ist kein guter Mensch.“ Trotzdem hatte er den Drang, zur Beerdigung zu gehen: „Ich musste dahin, um ihr am Grab zu verzeihen.“
Heute würde Jonas von sich selbst behaupten, dass er glücklich ist. Irgendwann möchte er Kinder, damit er sich beweisen kann, dass er ein besserer Vater als sein eigener sein kann. In einem von ihm noch unveröffentlichten Lied heißt es: „Mit jedem Blick zurück, gehe ich einen Schritt nach vorn.“
Helena Mälck
Hier geht es zum Careleaver-Netzwerk!

Schauen Sie doch mal in die aktuelle DOM-Ausgabe rein. Dort finden Sie eine Vielzahl an Berichten zur katholischen Kirche im Erzbistum Paderborn, deutschlandweit und auch weltweit. Es lohnt sich bestimmt.





