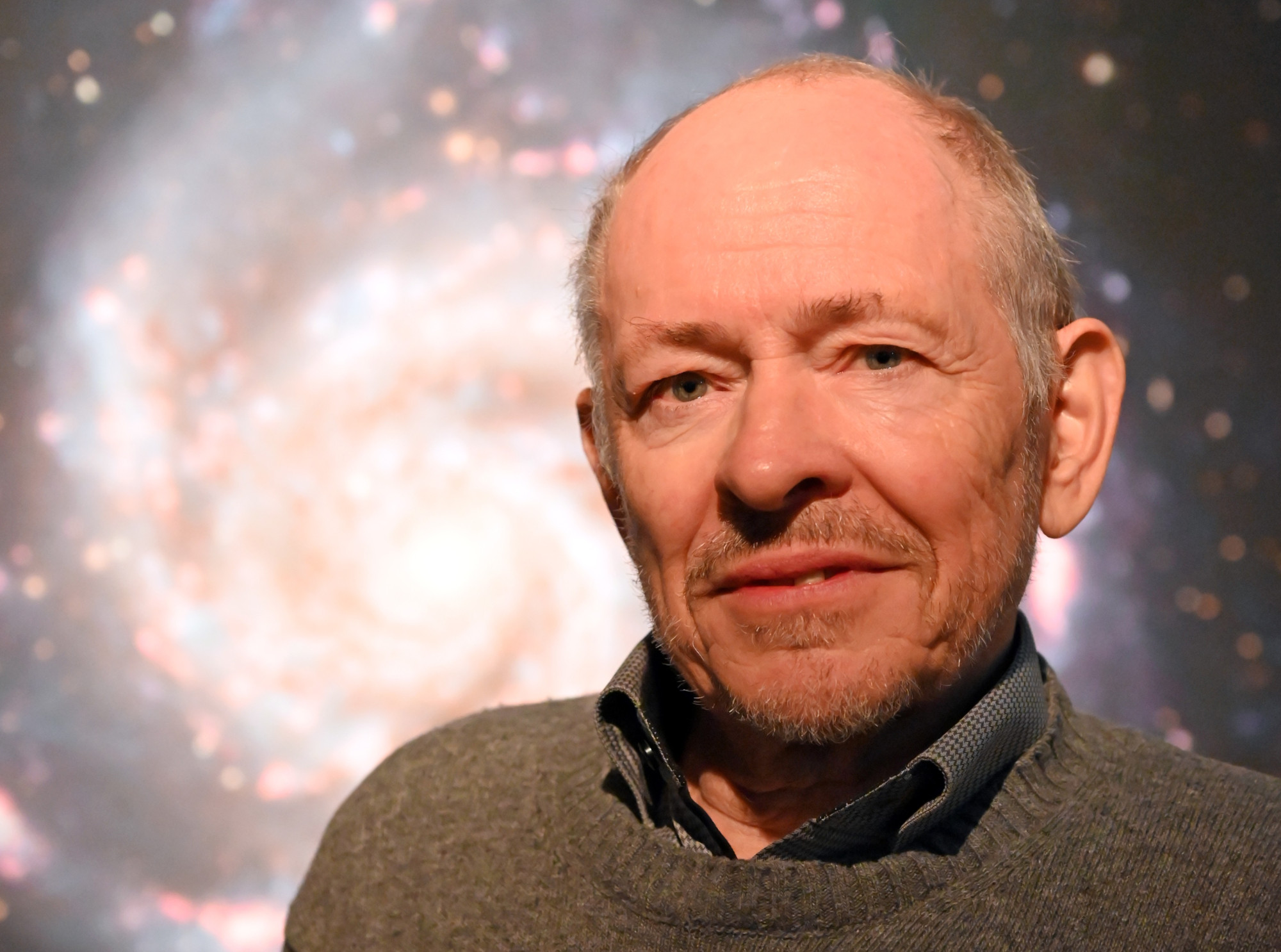Nehmen ohne geben, geht nicht

Karl-Heinz Baßler mit Ehefrau Sabine und Rauhhaardackel Fine. Foto: Saal
Menden. Karl-Heinz Baßler erzählt mit ruhiger Stimme, ohne große Gesten. Schon viele Male hat er es getan: vor Schulklassen, in Krankenhäusern. Nicht, weil er im Mittelpunkt stehen wollte. Sondern vor allem, weil er nachdenklich machen will. Er erzählt, selbst wenn ihm dann wieder die schlimmsten Momente vor Augen stehen – aber auch die schönsten Geschichten von Tod und Leben.
von Annette Saal
Nachdenklich schaut der stattliche Mann mit dem grauen Vollbart in den Garten. Gegenüber am Tisch sitzt Baßlers zweite Frau Sabine. In den Kissen auf der Holzbank hat sich Rauhhaardackel Fine gemütlich zusammengerollt. Viel mehr brauchen Baßlers nicht, um glücklich zu sein. Denn beinahe hätte der 69-Jährige aus Menden im Sauerland diese kleine Idylle nicht mehr erlebt.
2007 hat er eine neue Leber bekommen. Für ihn ein unglaubliches Geschenk: Die Tage seitdem waren angefüllt mit Dankbarkeit und Lebensfreude. Baßler hat auch andere Tage erlebt. Als seine Söhne, damals 13 und 17 Jahre alt, ihn plötzlich mit blanker Angst in der Stimme anriefen: „Mama atmet nicht mehr!“ Seine erste Frau hatte zwei Tage nach ihrem 50. Geburtstag einen Hirnschlag erlitten. Nie zuvor war sie ernsthaft krank gewesen. Chaos, Verzweiflung, Wiederbelebungsversuche, Blaulicht – Fragmente eines Schocks aus heiterem Himmel.
Baßler, seine Söhne und der Hausarzt sehen sich im Krankenhaus wieder. Der Hausarzt eröffnet ihm: „Leni ist tot.“ Bald darauf fragt der Arzt, ob sich die Familie eine Organspende vorstellen kann. Baßler will wissen: „Wie lange haben wir Zeit zum Überlegen?“ Die Antwort: „Nicht lange.“ Mit seinen Söhnen ist sich der Vater sofort einig: Alle sind einverstanden.
„Leni hatte keinen Organspendeausweis“, sagt Baßler. Aber gesprochen hätten sie vorher schon über das Thema. Seine Frau habe gesagt: „Ich habe damit kein Problem“, erinnert sich der 69-Jährige. „Aber wenn einer meiner Jungs auch nur den geringsten Zweifel gehabt hätte, hätten wir das nicht gemacht.“
„Die Menschen werden bei der Organspende sehr respektvoll behandelt“, sagt Baßler. Ein Koordinator habe überwacht, wie die Stecker der Geräte gezogen wurden, die die Organe der verstorbenen Frau funktionsfähig hielten. Baßler berichtet sachlich, mit fester Stimme. Zwei Neurologen aus unterschiedlichen Kliniken stellten unabhängig voneinander den Hirntod fest. „Wir hatten das Gefühl, dass alles richtig war.“
Das Gefühl, in dieser verzweifelten Situation, einem anderen Menschen neues Leben zu schenken. „Man kann doch kein gesundes Organ in die Erde graben!“ Baßler schaut wieder in den Garten. Er braucht einen Moment. Weiß er, wem die Organe seiner ersten Frau geholfen haben? „Das erfährt man nicht direkt.“ Aber es gibt eine Koordinationsstelle, über die auf Wunsch einige Anhaltspunkte zu erfahren sind – anonym.
Dann lächelt Baßler. „Ich habe erfahren, dass eine 29-jährige Frau eine Niere und die Bauchspeicheldrüse bekommen hat. Und ich weiß, dass sie kürzlich zum zweiten Mal Mutter geworden ist.“ Baßler zieht wieder das weiße Taschentuch hervor, schneuzt sich noch einmal. Seine Entscheidung hat ein Leben gerettet – und zwei weitere Leben ermöglicht.
Doch auch Baßler selbst verdankt sein Leben jemandem, der es verloren hat. Sachlich und gefasst berichtet der 69-Jährige von seinem Unfall 1970 bei der Bundeswehr, der eine Blutübertragung notwendig machte. Dabei infizierte er sich mit Hepatitis B – als 20- Jähriger.
Jahre später stellte sich heraus: Es hatte sich daraus eine Leberzirrhose entwickelt. Seine Milz war bereits von einem Tumor befallen und musste entfernt werden. Baßler hatte das Gefühl, der Krankheit etwas Gewichtiges entgegensetzen zu müssen: „Ich wog 135 Kilo.“
Lange Zeit blieb sein Gesundheitszustand einigermaßen stabil. Doch der plötzliche Tod seiner ersten Frau löste bei ihm eine existenzielle Krise aus. „Ich war total am Ende“, berichtet er. „Innerhalb eines Jahres habe ich mich auf 68 Kilo heruntergehungert.“ Antworten auf seine seelische Not suchte er im Extremsport. „Ich habe angefangen zu laufen: Marathon, einen Iron Man, einen Hundert-Kilometer-Lauf quer über die Alpen.“ Den Kilimandscharo zu besteigen, war eine weitere Herausforderung, der er sich erfolgreich stellte. „Ich bin vor mir selber davongelaufen“, gibt Baßler zu. „Dahinter stand der Gedanke: Einer, der das alles kann, kann doch nicht ernsthaft krank sein!“
Doch Baßler war krank – schwerkrank. Das merkten er und seine zweite Frau immer deutlicher. Die immer schwächer werdende Leber hatte Folgen. Es kam zu einer schleichenden Ammoniakvergiftung im Gehirn. Nachts quälten ihn im Halbstundenrhythmus Krämpfe, in der Speiseröhre bildeten sich Krampfadern.
Die Vergiftung hatte auch psychische Folgen. Der Kranke reagierte nicht mehr berechenbar. „Er ist nachts 15 Kilometer nach Hause gegangen, weil er eine Situation nicht mehr ertrug“, erinnert sich seine Frau Sabine. „Ich habe Sachen gesehen, die es nicht gab“, ergänzt Baßler. Die Krankenhausaufenthalte häuften sich: „Ich war nur noch ein Wrack.“
Eines Tages hielt er es nicht mehr aus. Er hatte einen Bekannten wiedergesehen, der ebenfalls an Leberzirrhose litt und nur noch ein Schatten seiner selbst war. „So wollte ich nicht enden. Ich war drauf und dran, mir eine Flasche Schnaps zu nehmen und in den Wald zu gehen. Ich wollte Schluss machen.“ Nur die Entschlossenheit seiner Frau hat ihn daran gehindert. Sie rief in der Universitätsklinik Münster an, benachrichtigte einen Freund von Baßler, der wiederum dessen älteren Bruder alarmierte. „Ich wollte, dass du dir anhörst, dass du noch eine Möglichkeit hast“, sagt Sabine Baßler nachdrücklich.
Schließlich lenkte Baßler ein. Ließ sich in die Klinik fahren. „Sie brauchen eine neue Leber“, hieß es dort. Baßler wurde auf eine Warteliste für eine Lebertransplantation gesetzt. „Viel mehr als vier Wochen hatte ich nicht mehr.“ Vier Tage später klingelt bei ihm das Telefon, um Mitternacht. Die Uniklinik! Es gab eine Spenderleber für ihn.Baßler bestellt ein Taxi, nimmt seine Frau und einen der Söhne mit. Die Transplantation dauert zwölf Stunden.
Baßler hatte zuvor mit allem abgeschlossen. „Ich war ganz ruhig. „Als ich irgendwann aufwachte, habe ich den Pfleger gefragt, ob ich ihn mal anfassen dürfe. Ich dachte, ich wäre im Himmel.“ War er aber nicht, sondern auf der Erde. Mit seiner Frau an der Seite. Baßler zückt wieder sein Taschentuch, steckt es nach wenigen Sekunden wieder weg. Liebevoll schaut er seine Frau an. Das Erlebte hat sie eng zusammengeschweißt. „Wir machen alles zusammen“, lächelt Sabine Baßler. Die beiden genießen die kleinen Dinge des Lebens, die vorher so selbstverständlich schienen. Baßler trainiert seine geliebten Hunde, geht wieder auf die Jagd, hilft seiner Frau in der Goldschmiedewerkstatt. Wenn sie gemeinsam ausreiten oder lange Spaziergänge durch den Wald machen, sind sie glücklich.
Karl-Heinz Baßler fühlt sich wohl mit seiner neuen Leber. Er muss zwar sein Leben lang Medikamente nehmen, die Abwehrreaktionen gegen das Organ unterdrücken. „Aber daran gewöhnt man sich.“ Wenn Gäste kommen und ihn per Handschlag begrüßen, desinfiziert er sich danach kurz die Hände.
Wie fühlt es sich an, ein neues Organ zu haben? Baßler weiß, dass die Leber von einem Mann stammt, der mit etwa 50 Jahren gestorben ist. „Ich merke nicht, dass ich eine andere Leber habe“, sagt er. Auch vom Kopf her hat er damit kein Problem: „Es ist ein Geschenk“, betont er. „Aber es ist meins.“ Sein großer Wunsch ist, dass andere Patienten, die sehnlichst auf ein lebensrettendes Organ warten, ebenfalls ein solches Geschenk bekommen. „Das geht aber nur, wenn sich die Leute mit dem Thema befassen und bereit sind, im Fall eines Falles als Organspender zur Verfügung zu stehen.“ Dieses Anliegen treibt ihn an, in Schulklassen und Kliniken immer wieder von seinem Schicksal zu erzählen.
Er selbst ist mehr als froh über seine damalige Entscheidung, die Organe seiner ersten Frau für eine Transplantation zur Verfügung gestellt zu haben. Sonst hätte er die Leber für sich selbst kaum annehmen können. „Wenn ich nicht bereit bin zu geben, aber nehmen will – das passt nicht.“
Ein Interview zum Thema finden Sie in der Printausgabe des Dom Nr. 45 vom 10. November 2019