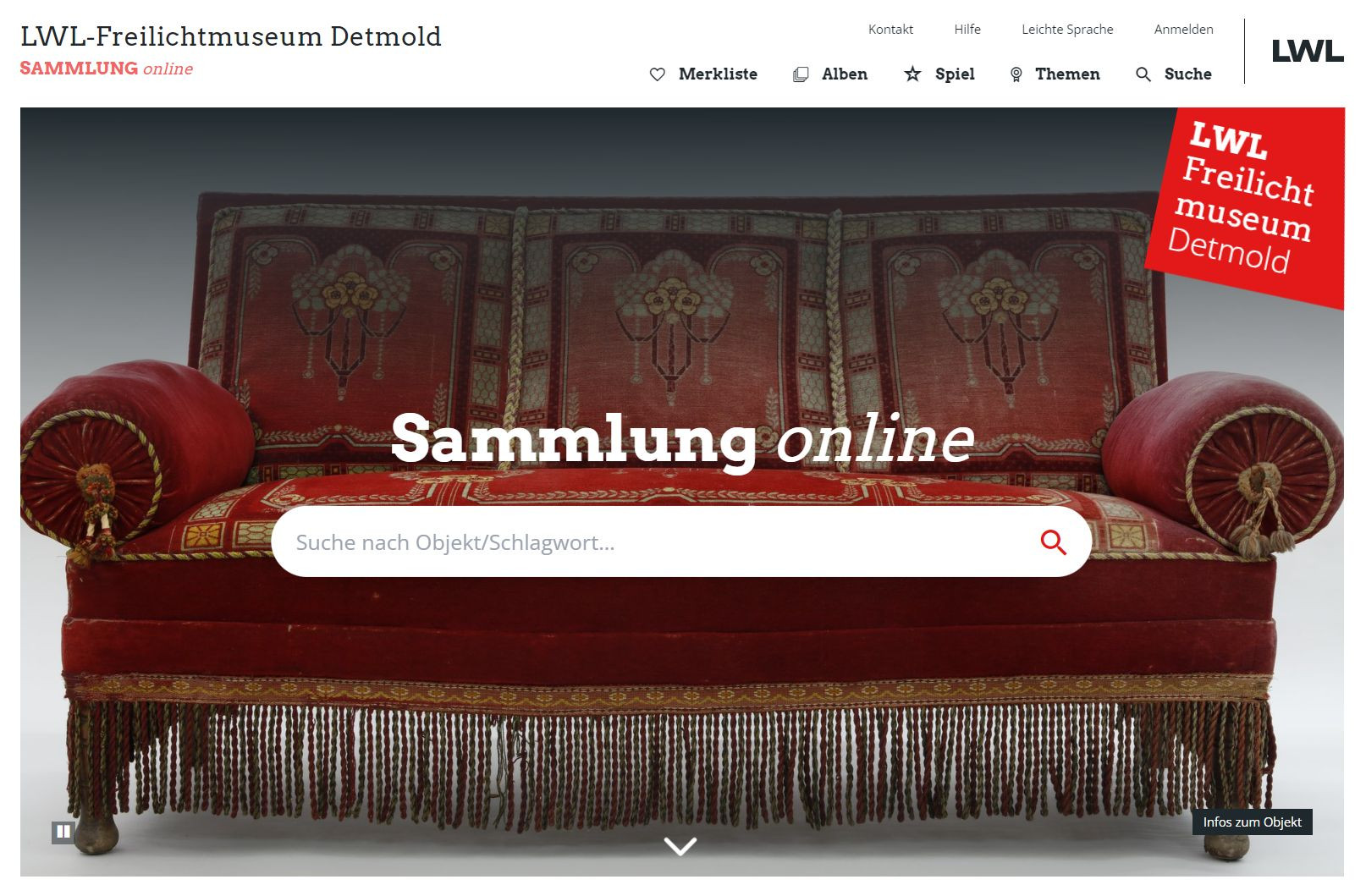Rituale können hilfreich sein

Rituale können hilfreich sein
Bonn (KNA). Wenn ein Mensch stirbt, sind Familie und Freunde oft hilflos. Aber gerade in einer solchen Situation müssen sie viele Dinge regeln und organisieren rund um Abschiednehmen, Trauerfeier und Bestattung. Da können religiöse und soziale Rituale eine Stütze sein – sofern sie bekannt sind und in einer weitgehend säkularen Gesellschaft in Deutschland akzeptiert werden. Christentum, Judentum und Islam haben für die Zeit der Trauer eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die Halt in einer schwierigen Zeit geben sollen.
von Leticia Witte
und Christoph Schmidt
„Ohne Rituale wird Trauer zu einem Problem“, sagt der frühere langjährige Geschäftsführer des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur und evangelische Pfarrer Oliver Wirthmann. Die katholische Kirche kenne verschiedene Stationen des Abschiedes: Vor dem Tod eines Menschen spende ein Priester Krankensalbung und Krankenkommunion und spreche ein Gebet im Sterbezimmer. Nach dem Tod würden Rosenkränze vor der Trauerfeier gebetet, danach folgten das Requiem und die Beisetzung. Später dann Sechswochenamt und Jahresgedächtnis.
Dass es in dieser Form abläuft, ist in vielen Regionen Deutschlands allerdings nicht mehr der Fall. „Der Tod ist ein ganzes Stück unsichtbarer geworden“, betont Wirthmann. Nur wenige Menschen verhängen heute noch Spiegel in einem Haus, in dem jemand gestorben ist. Ein bisschen häufiger noch wird das Fenster geöffnet, damit die Seele entweichen kann. Und längst nicht mehr tragen Angehörige eines Verstorbenen schwarze Kleidung oder halten das Trauerjahr ein.
„In der Gegenwartskultur zeigt sich eine Entfremdung von den Trauerritualen hin zu inszenatorischen Dramatiken“, so Wirthmann, der vor seinem Konfessionswechsel katholischer Pfarrer war. Damit ist gemeint, dass etwa bei Beerdigungen zunehmend säkulare Musik oder andere individuelle Elemente gewünscht würden. Jeder Pfarrer müsse entscheiden, ob das möglich sei, betont Wirthmann. Er hat außerdem beobachtet, dass Angehörige oder Freunde Trauerfeiern mitunter gar nicht mehr wollen – und im kleinen Kreis Abschied am Grab nehmen.
Die Trauer werde oft privat gehalten, bilanziert Wirthmann. Der Grund könne sein, dass man keine „Schwäche“ zeigen und souverän erscheinen wolle. Bei all dem macht der Fachmann ein Stadt-Land-Gefälle aus, wobei auch in ländlichen Regionen Rituale langsam auf dem Rückzug seien – die religiöse Praxis schwinde.
Ähnliche Entwicklungen stellt Daniel Lemberg für das Judentum fest. Der Friedhofsverwalter der orthodox geführten Einheitsgemeinde in Köln sagt, viele Menschen wüssten in einer verweltlichten Gesellschaft nicht mehr, welche Traditionen es nach dem jüdischen Religionsgesetz, der Halacha, rund um Tod und Trauer gebe. Etwa die Trauerzeiten: Die erste liegt in der kurzen Zeit zwischen Tod und Bestattung. Die nächsten Angehörigen wie Eltern, Ehepartner, Kinder und Geschwister sind von vielen Pflichten entbunden, nehmen etwa weder Fleisch noch Wein zu sich und rasieren sich auch nicht.
Vor, beziehungsweise während der Beisetzung machen die nächsten Angehörigen einen Riss in ein Hemd oder eine Bluse als Zeichen der Trauer. Eine spezielle Trauerkleidung gebe es nicht, sagt Lemberg. Nach der Beisetzung kommen in den ersten sieben Tagen diese Angehörigen zum „Schiwesitzen“ zusammen. Sie sollen in der Zeit möglichst nicht arbeiten und kochen, sitzen auf niedrigen Schemeln, sie bekommen Besuch von Verwandten und Freunden und gedenken des Verstorbenen.
Nach einem Jahr wird gewöhnlich in Europa der Grabstein gesetzt, in Israel bereits nach 30 Tagen. Mit diesem Jahrestag, der „Jahrzeit“, finden die Trauerphasen ihren Abschluss. In Europa ist es üblich, das Grab erst nach einem Jahr zu besuchen, wenn der Grabstein gesetzt wird. Diese Tradition ist aber gelegentlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Die Abstufungen sollten zeigen, dass die Intensität der Trauer langsam abnehme und Angehörige nach und nach wieder am Leben teilnähmen und danach zum Beispiel auch wieder Feiern besuchten, erläutert Lemberg.
In der weiträumigen islamischen Welt hat sich eine Vielzahl von Trauerritualen entwickelt. Bilder muslimischer Frauen, die den Verlust laut und völlig aufgelöst beweinen, sind dafür nicht unbedingt typisch. Mohammed soll seiner Gemeinde zurückhaltendes Trauern empfohlen haben.
Auffallend an der Trauerkultur im Islam ist die warme Anteilnahme der Gemeinschaft. Nach der Beisetzung, an der traditionell nur die Männer teilnehmen, beginnt für die Familie eine mehrtägige zurückgezogene Phase. Während sie Beileidsbesuche empfängt und sich an den Verstorbenen erinnert, kümmern sich Verwandte ums Kochen und um Behördengänge. Die Trauerzeit mit Koranrezitationen für den Toten dauert 40 Tage und endet mit einem großen Essen. Ein Jahr lang sollten keine wichtigen Feste wie Hochzeiten gefeiert werden.
„Einige Traditionen werden von den hier lebenden Muslimen sehr gepflegt – im Gegensatz zu vielen Großstadtbewohnern der Herkunftsländer“, sagt die Kulturwissenschaftlerin Gudrun Zimmermann. Die Migranten seien da oft sehr viel konservativer.
In Deutschland sind regelmäßige Besuche am Grab oft nicht möglich, denn noch immer lässt sich ein Großteil der Muslime in der Heimat der Vorfahren bestatten. Allerdings kennt der Islam ohnehin keine intensive Grabpflege – Ehre gebührt nur Allah. Für westliche Augen wirken muslimische Gräber deshalb oft verwahrlost. Muslime pflegen die Erinnerung auch ohne Blumenbeet.