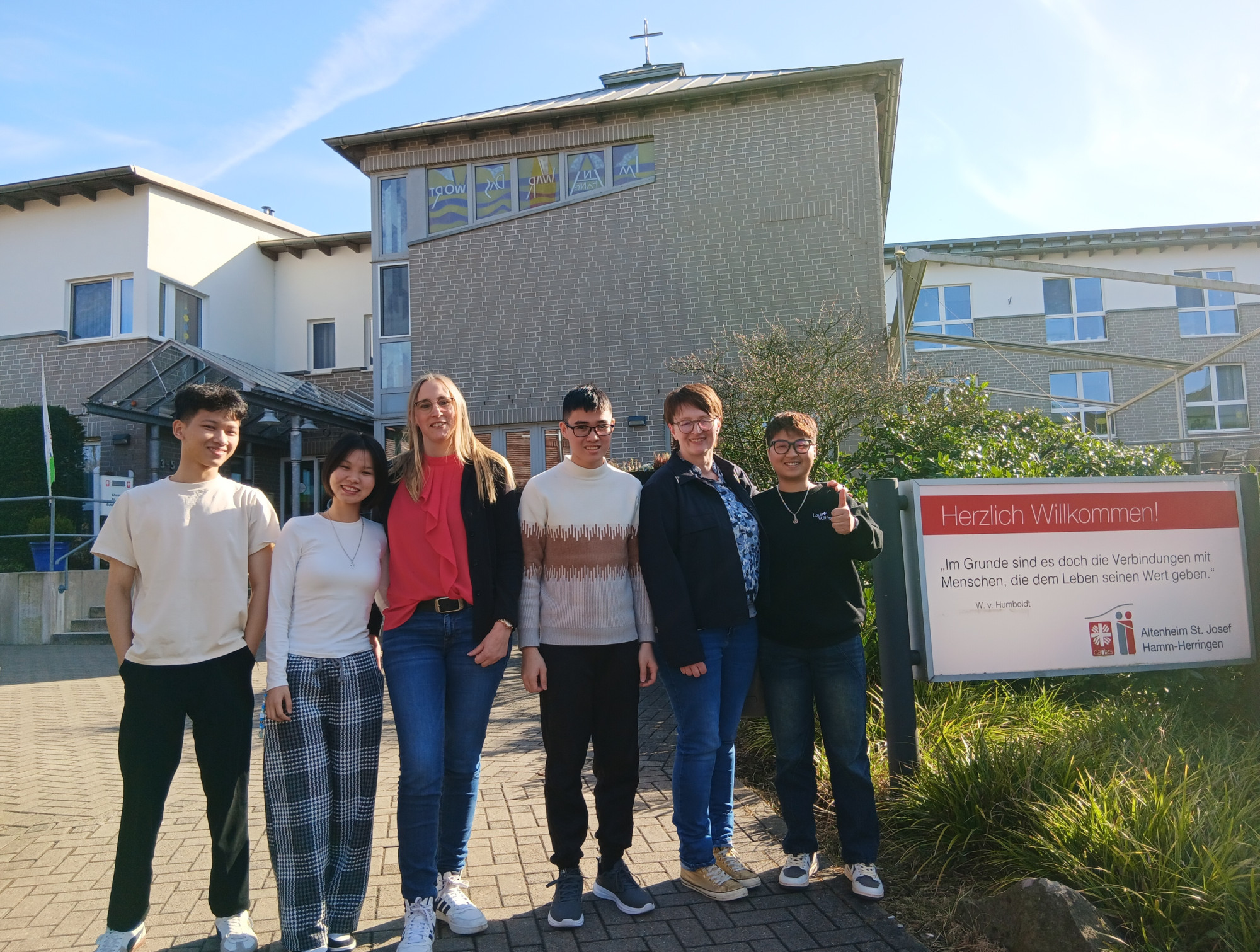Deutschland aus einer anderen Sicht
Evelyne Waithira Müller stammt aus Kenia und wurde in Ostwestfalen heimisch. Über ihre Erfahrungen in und mit Deutschland hat die Religionspsychologin das Buch „Frau Müller, die Migrantin“ geschrieben, das Themen wie Einsamkeit und Rassismus im Alltag aufgreift.
Frau Müller, gab es einen Auslöser, Ihr Buch zu schreiben?
Das ist eine längere Geschichte. Ich wollte immer ein Buch schreiben. 2020 war ich dann selbstständig. Da habe ich gedacht: „Okay, jetzt ist Zeit dafür.“ Ich habe auf Deutsch geschrieben zum Thema „Wie führt man ein sinnerfülltes Leben?“. Als ich fertig war, habe ich einer Freundin das Buch zum Lesen gegeben. Sie meinte: „Schreibe lieber auf Englisch, da kommen deine Gefühle besser rüber.“ Das habe ich dann aber gelassen.
Dabei ist es aber nicht geblieben …
2021 habe ich mich zusammen mit einer Kenianerin über das Thema „Das Leben hier in Deutschland“ ausgetauscht. Das war zuerst rein privat. Dann haben wir gedacht: „Wie wäre es, wenn wir ein Buch darüber schreiben?“ Es ging hin und her, dann haben wir uns Gedanken gemacht und sie schriftlich festgehalten. Leider hat sie dann entschieden, dass sie nicht weitermachen kann. Da war ich aber schon weit im Buchprojekt drin.
Hatten Sie beim Schreiben eine Zielgruppe vor Augen?
Ich schreibe in erster Linie für Migranten, die hierherkommen. Ich will ihnen zeigen, welche Herausforderungen – auch emotional – sie wahrscheinlich hier erleben werden. Als das Buch in die Korrektur ging, sagten meine deutschen und europäischen Freunde: „Das ist total spannend. Das zeigt uns Deutschland aus einer anderen Sicht.“ Wir haben das Buch dann so angepasst, dass sich Menschen, die schon immer hier leben, angesprochen fühlen. Gleichzeitig will ich Migranten etwas mitgeben. Das sind Dinge, die ich selbst in der Flüchtlings- und Migrationsarbeit mitbekommen habe, aber auch eigene Erfahrungen.
In Ihrem Buch ist von Einsamkeit die Rede. Wie kann man aus dieser Einsamkeit herauskommen? Wie wichtig ist die deutsche Sprache dabei?
Natürlich spielt die Sprache eine wichtige Rolle. Wenn ich mich besser ausdrücken kann, besser kommunizieren kann, dann habe ich einen anderen Zugang zu den Menschen. Man muss aber in Deutschland auch wissen, wie man mit Menschen in Kontakt kommt.
Das ist schwieriger als etwa in Ihrem Heimatland Kenia?
Dort spricht jeder mit jedem. Gastfreundschaft wird großgeschrieben. Wenn man merkt, dass jemand neu eingezogen ist und man ihn nicht kennt, gerade dann geht man zu ihm. Man versucht, die Person einzubinden. Hier ist es anders. Hier muss man wissen, wo sich Menschen treffen, zum Beispiel in Vereinen.
In Vereinen besteht die Gefahr, dass man als neues Mitglied erst einmal ignoriert wird.
Das stimmt, da braucht man Durchhaltevermögen. Hier in Deutschland dauert es zwei oder drei Jahre, bis die Leute mit einem warm werden. Das ist anstrengend. In Vereinen oder Kirchengemeinden hat man bessere Chancen, Kontakte zu knüpfen. Warten, bis jemand auf mich zukommt, das funktioniert in der Regel nicht.
Wie erleben Sie die Situation am Arbeitsplatz?
Hier in Deutschland trennt man Arbeit und Privates. Das ist in vielen Kulturen komplett anders. Eine Frau, die seit drei Jahren hier lebt und für ein kirchliches Projekt arbeitet, sagte neulich zu mir: „Ich komme gar nicht in Kontakt mit den Arbeitskollegen.“ Da musste ich ihr erklären: „Ja, das ist hier so.“ Die Kolleginnen und Kollegen sind nett und freundlich bei der Arbeit, aber auch distanziert. So drückt man hier Professionalität aus. Das zu verstehen, wenn man aus einem anderen Kontext kommt, ist echt schwer.
Wie sind die Reaktionen, wenn Sie Lesungen machen?
Es gibt viele Reaktionen, eine sehr große Betroffenheit, die Leute sind schockiert. Bei meiner Premiere waren viele Leute da, auch Migranten. Als es um das Thema Rassismus ging, fragte ein älterer Herr: „Ist das nur hier im Dorf so?“ Nein, das ist auch in Städten so. Eine Freundin von mir kommt aus Heidelberg. Sie sagte: „Ich mache die gleichen Erfahrungen, obwohl ich in einer Großstadt, die ziemlich multi-kulti ist, lebe.“ Viele weiße Menschen können sich das einfach nicht vorstellen, weil sie keinen Rassismus erleben.
Wie äußert sich Rassismus im Alltag?
Man denkt, das gibt es nur in der extremen Form, dass Nazis etwa Leute verjagen. Aber wenn ich irgendwo hingehe und nicht angesprochen werde, oder man mir gebrauchte Kleider schenkt, weil man glaubt, dass alle Afrikaner arm sind – das ist auch Rassismus. Wenn Leute darüber nachdenken, merken sie schnell: „Das geht gar nicht!“ Ich will ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es dieses Problem überhaupt gibt. Darüber vor Leuten zu reden, wäre vor fünf Jahren noch nicht möglich gewesen.
Vor fünf Jahren wäre Rassismus kein Thema für eine öffentliche Veranstaltung gewesen?
Das Thema ist nach dem Tod von George Floyd durch die Polizei in den USA in Deutschland ein Thema.
Migration ist ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Wie nehmen Sie die Diskussion wahr?
In der Politik wird leider eher negativ über Migranten gesprochen, obwohl Olaf Scholz 2024 in sehr vielen Ländern war, um für Arbeitskräfte zu werben. Er war zum Beispiel in Kenia, Indien oder Ghana. Darüber wird nicht groß in den Medien gesprochen. In Deutschland gibt es zu wenige Fachkräfte. Migranten halten das System zusammen.
Wie kann die Kirche bei der Integration unterstützen?
In Dortmund, Paderborn und Bielefeld gibt es zum Beispiel afrikanische Kirchengemeinden. Ich finde es richtig toll, dass die katholische Kirche das mit Räumen, Finanzen und Personal unterstützt. Natürlich gibt es immer noch Luft nach oben, aber es wird bereits einiges getan.
Wie reagieren Sie auf Klischees über Afrika, etwa dass dort nur arme Menschen leben?
Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Das heißt aber nicht, dass ich das gut finde. Kindern wird in der Schule wenig über Afrika beigebracht. Ich habe Leute getroffen, die dachten, Afrika sei ein Land. Es gibt viele große Länder auf dem afrikanischen Kontinent, auch verschiedene Sozialschichten. Anstrengend wird es, wenn einem nichts zugetraut wird, weil man aus Afrika stamme. Das ärgert einen. Auch Afrikaner möchten behandelt werden wie jeder andere auch.
Haben Sie das Gefühl, dass afrikanische Sprachen oder Kulturen nicht gleichberechtigt gesehen werden?
Wenn mein Mann, der weiß ist, sagt, dass er vier Sprachen spricht, gäbe es viel Anerkennung. Viele Afrikanerinnen und Afrikaner sprechen mehrere Sprachen. Dafür bekommt man nicht die gleiche Anerkennung. Und generell werden nicht europäische Sprachen als minderwertiger angesehen als Französisch oder Spanisch.
Heimat ist da, wo ich Freunde und Familie habe und gute Erfahrungen gemacht habe. Von daher sind es doch beide Länder, Kenia und Deutschland.
Wo sehen Sie ihre Heimat?
Zur Person
Evelyne Waithira Müller, Jahrgang 1984, ist gebürtige Kenianerin und war als junge Frau Berufssoldatin beim britischen Militär. Sie sammelte weitere berufliche Erfahrungen unter anderem in der Flüchtlingsarbeit, in der Beratungs- und Präventionsarbeit gegen islamistischen Extremismus und in der Telefonseelsorge. Sie ist verheiratet und Mutter eines Sohnes. Ihr Buch ist im Bonifatius-Verlag Paderborn erschienen.