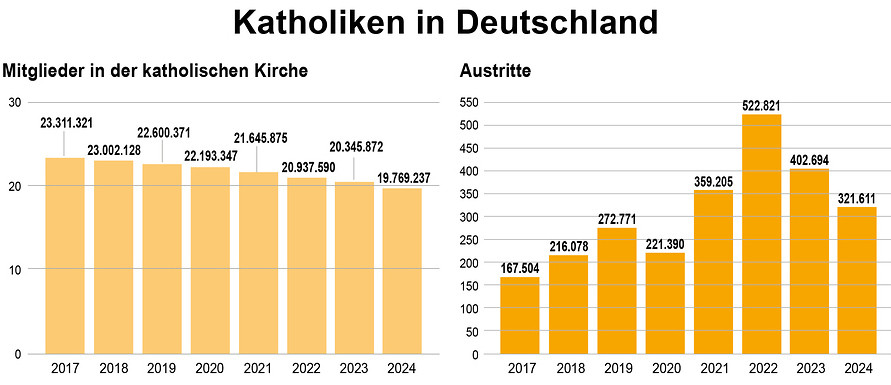Heilige Kühe und Flüsse
Religionen und Umwelt in Indien.
Indien ist ein unglaublich vielfältiges Land. Zwischen den Bergen des Himalaya und dem Indischen Ozean leben rund 1,3 Milliarden Menschen, die mehr als 100 Sprachen sprechen. Der Subkontinent ist zudem der Geburtsort der vier großen Religionen Hinduismus, Buddhismus, Jainismus und Sikhismus. Hinzu kommen zahlreiche Stammesreligionen. Durch die Mogul-Kaiser kamen der Islam sowie durch Missionare im ersten Jahrhundert und später durch europäische Kolonialisten und Missionare das Christentum ins Land.
Als dominierende Religion gilt der Hinduismus. Das aber ist eher ein Überbegriff für eine Vielfalt indischer religiöser und spiritueller Traditionen. Während Judentum, Christentum und Islam sich auf einen Stifter, einen Text, einen Namen berufen, spricht man in Indien „eher von verschiedenen, aber im Prinzip gleichwertigen Wegen (marga, pantha), Doktrinen (mata, vada), Philosophien (darsana) oder Traditionen (sampradaya) als von einer gemeinsamen Religion“, so Axel Michaelis in seinem Buch „Der Hinduismus – Geschichte und Gegenwart“.
„Die einzelnen Kulte, Sekten, Philosophien und theistischen Systeme“ im sogenannten Hinduismus, so der Indologe und Religionswissenschaftler von der Universität Heidelberg weiter, seien „kognitive Systeme oder sozio-religiöse Institutionen einer Gesellschaft, die sich auf eine prinzipielle Austauschbarkeit und Identität der Glaubenssysteme verständigt hat“.

So vielfältig und komplex wie der Hinduismus ist auch die Natur Indiens, das aufgrund seiner vielfältigen Klimazonen und Ökosysteme eines der artenreichsten Länder der Welt ist. Über 45.000 Pflanzenarten grünen und blühen in Indien. Unter den 100.000 Tierarten finden sich die ikonischen Säugetiere Bengalischer Tiger, Indischer Elefant, Asiatischer Löwe, Panzernashorn und Schneeleopard.
Viele dieser Tiere und Pflanzen sowie bei den Ökosystemen vor allem die großen Flüsse spielen in Religion, Kultur und Lebensweisen eine prominente Rolle. Wegen ihrer tiefen Verwurzelung in der indischen Religion wurden zum Beispiel die Ganges-Delfine von der Regierung zum „nationalen Wassertier“ erklärt: als Sinnbild von Varuna, dem uralten vedischen Gott für Wasser sowie der kosmischen und moralischen Ordnung.
Viele Elemente der Natur gelten im Hinduismus als göttlich oder heilig. Am bekanntesten sind heilige Kühe. Sie repräsentieren das Leben sowie die Erde und gelten als stets gebende Versorger und Ernährer. Bäume wie der Banyanbaum oder die heilige Feige (Pipal) werden spirituell verehrt. Die Berge des Himalaya gelten als Wohnort der Götter. Wie der elefantenköpfige Ganesha werden so manche Götter des hinduistischen Olymp auch im Buddhismus und im Jainismus verehrt.
Von immenser Bedeutung ist auf dem indischen Subkontinent – Pakistan, Indien und Bangladesch – aber die „Religion der Flüsse“. Die mächtigen, als heilig und göttlich gesehenen Ströme Indus, Ganges und Brahmaputra fließen vom Himalaya über Tausende Kilometer ins Meer. In der Mythologie des Hinduismus gilt der Ganges als Göttin, die das Wasser zur Erde brachte.
„Die Heiligkeit ihres Stroms segnete das Land mit Fruchtbarkeit und Überfluss und brachte Frieden und Leichtigkeit in das Leben der Uferbewohner“, schreibt Umme Sayeda in ihrem Artikel „Die Flusskultur ist rhythmischer Puls des bengalischen Deltas“. Aber auch der mit einer Hindu verheiratete muslimische Mogul-Kaiser Akbar (1556-1605) sei dem Ganges spirituell eng verbunden gewesen. Sayeda weiß auch: „Anhänger des Hinduismus, Buddhismus und Jainismus verehren den Brahmaputra, den einzigen männlichen Fluss, mit vielfältigen farbenfrohen Ritualen.“

Sarita Kar vom „Indian Institute of Technology“ betont in ihrer 2022 veröffentlichten Arbeit „Die Rolle der Religion in der ökologischen Nachhaltigkeit: Eine indische Perspektive“: „Die Rolle der Religion bei der Gestaltung unserer Einstellung zur natürlichen Welt ist bedeutsam, da ihre dominierende Rolle in der menschlichen Persönlichkeit immer erkennbar ist.“ Über die indischen Religionen seien „umweltfreundliche ethische Standards“ über Generationen weitergegeben worden.
Viele indische Naturschutzorganisationen und -programme berufen sich bei ihren Aktivitäten dezidiert auf Religionen. EcoSikh zum Beispiel hat im Punjab, dem Kernland der Sikh, bereits 850 „Miniwälder“ zur Förderung der Vielfalt von Flora und Fauna gepflanzt. Ein renommierter Umweltpreis wurde nach der Umweltschützerin und Märtyrerin Amrita Devi benannt. Amrita Devi wurde im 18. Jahrhundert enthauptet, weil sie die Fällung der vom Volk der Bishnoi als heilig angesehen Khejri-Bäume verhindern wollte. Die Landesregierung von Uttar Pradesh setzt in ihrer Kampagne zum Erhalt der bedrohten Art der Ganges-Delfine uralte hinduistische Texte ein.
Auf der anderen Seite ist es um die heilige Umwelt Indiens schlecht bestellt. Der Ganges und andere Flüsse sind streckenweise zu Kloaken geworden. Der Klimawandel lässt Temperaturen steigen, Gletscher schmelzen, Meeresspiegel steigen und den lebenswichtigen Monsun unregelmäßiger werden. Indiens Regierung schaut dem nicht tatenlos zu. Bis 2070 will Indien klimaneutral werden. Es wird massiv in Solar- und Windenergie investiert und in städtischen Gebieten werden Standards für umweltfreundliches Bauen und Elektromobilität umgesetzt.
Das Vertrauen in Technik und Wissenschaft ist für Sarita Kar aber auch eine Ursache für die zunehmende Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber der Natur. „Als die Wissenschaft begann, Stück für Stück die Geheimnisse der Natur zu enthüllen, verlor die Menschheit allmählich den Glauben an theistische Religionen“, so Kar. „In der Folge wurden auch moralische und spirituelle Werte verworfen.“