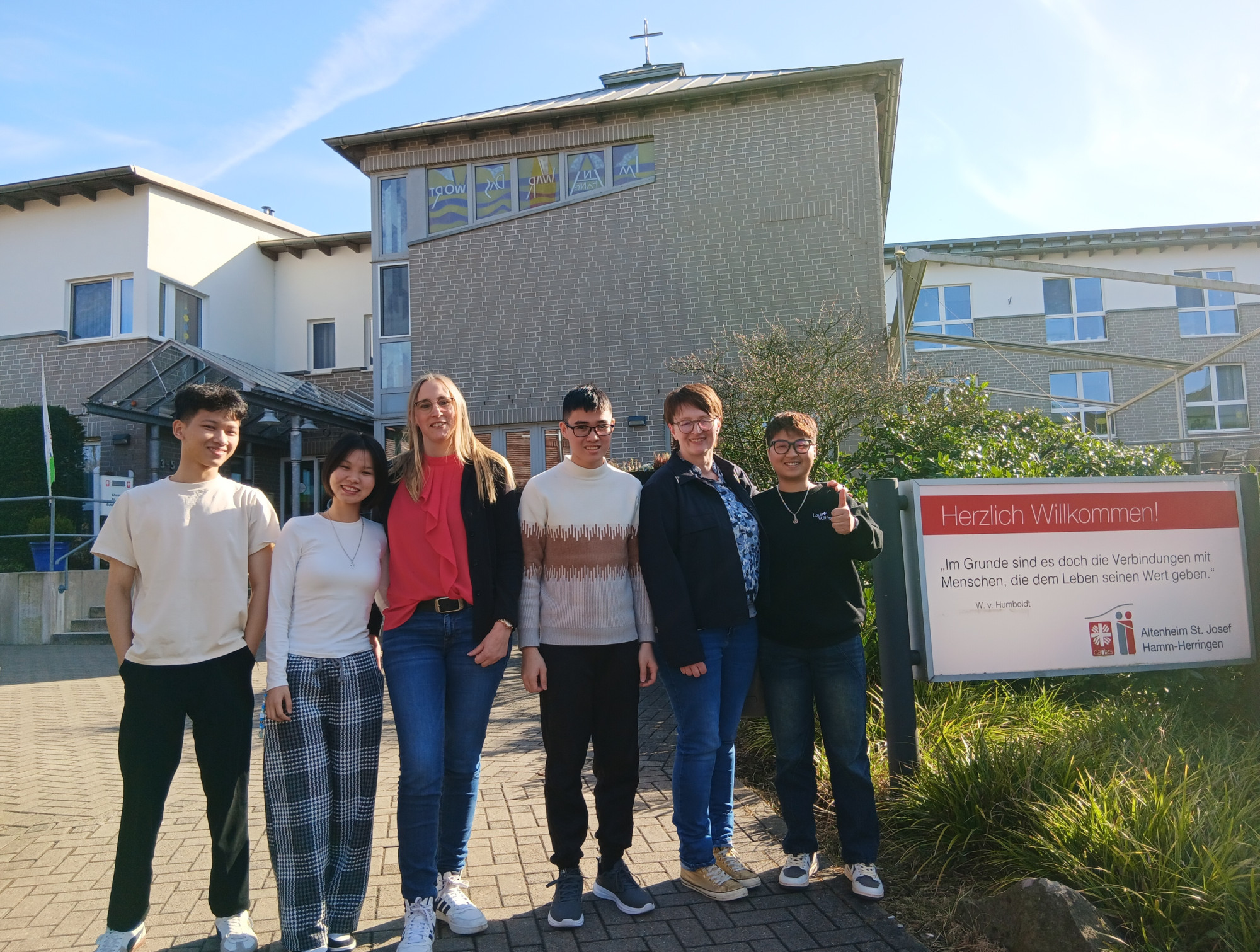„Keiner lebt gerne in einer ständigen Ungewissheit“
Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz ist seit seinem Amtsantritt viel gereist, traf viele Menschen und auch bereits harte Entscheidungen. Im Gespräch mit dem Dom blickt er zudem auf die drängenden Themen des neuen Jahres.
Herr Erzbischof, Sie haben sich viel Zeit genommen, durch die Dekanate zu reisen. Wenn Sie die Menschen dort treffen, herrscht Festtagsstimmung. Welches Bild konnten Sie gewinnen und wie realistisch kann dieses Bild sein?
Für mich war das auch eine Premiere, nicht nur für die Menschen. Die Dekanate hatten keine Vorgaben, es wurden nur ein paar grundsätzliche und organisatorische Dinge festgelegt: Das sollte einmal die Begegnung mit den Hauptberuflichen sein. Aber dann sollte die Möglichkeit gegeben sein, mit Ehrenamtlichen und Engagierten aus den Gemeinden zusammenzutreffen. Im Zentrum stand dann auch eine gemeinsame gottesdienstliche Feier. Besonders wollte ich etwas kennenlernen, was das Dekanat kennzeichnet. Von daher gab es natürlich so etwas wie „Wir zeigen, wer wir sind“ in einem ganz positiven Sinne. Dahinter steht zu Recht viel Selbstbewusstsein. Gleichzeitig bot jeder Dekanatstag auch die Möglichkeit, Einzelgespräche mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen zu führen. Es gab etliche Momente, in denen die Menschen nicht nur die Schokoladenseite gezeigt haben, sondern auch geklagt haben, was nicht funktioniert, was nicht geht und was nicht mehr geht. Der erste Eindruck ist wichtig, weil er prägt.
Aber klar, nicht alles ist benannt worden. Ich kann jetzt sagen, dass ich für die ganz unterschiedlichen pastoralen Situationen, kulturellen, landschaftlichen und sozialräumlichen Unterschiede ein allererstes Gespür bekommen habe.
Ehrenamtliche sind in der Regel noch motiviert. Was muss geschehen, dass aus motivierten Christinnen und Christen keine unmotivierten werden?
Hier sind mir mehrere Dinge wichtig. Wie wir künftig unsere seelsorgliche Arbeit gestalten und strukturieren, ist im Umbruch und noch offen. Es gibt noch nicht das klare Bild, wohin wir uns entwickeln. Ehrenamtliche wollen aber Klarheit, wollen wissen, worauf sie sich einlassen. Deswegen ist es wichtig, dass wir möglichst rasch mit den Menschen Überlegungen für die Zukunft konkretisieren, um zu klaren Zielperspektiven zu kommen. Wie werden die Strukturen aussehen? Was heißt verbindliche Sicherung der Seelsorge? Darüber braucht es Klarheit. Das brauchen auch die Hauptamtlichen. Keiner lebt gerne in einer ständigen Ungewissheit.
Das Zweite ist: Ehrenamt braucht, so erlebe ich es, Wertschätzung. Das ist fast banal. Für mich heißt Ehrenamtswertschätzung in Kontakt, in Beziehung, in Kommunikation zu sein. Die Menschen, denen ich begegnet bin, haben gesagt: „Es ist gut, mit Ihnen direkt reden zu können, zu spüren: Sie hören zu, Sie bringen Ihre eigenen Gedanken mit ein in unsere Gespräche.“ Aufeinander hören und Wahrnehmungen miteinander teilen, das ist ein wichtiges Kennzeichen synodaler Kultur. Das muss auf allen Ebenen passieren, das motiviert. Ehrenamt möchte auch Kompetenz haben.
Kompetenz setzt voraus, dass wir auch dazu befähigen. Die Menschen sollen nicht nur Aufgaben übernehmen, sondern auch einen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum bekommen. Wir sollten nicht mehr sagen: „Es gibt die und die Aufgabe, und jetzt brauchen wir Menschen, die das machen.“ Sondern: „Wer initiiert mit welchen Gaben und Befähigungen Leben vor Ort?“

Wie wollen Sie Ihre Rolle als Erzbischof ausfüllen? Woran orientieren Sie sich? An anderen Bischöfen oder eventuell auch an Firmenchefs?
Weder das eine noch das andere. In der Regel ist es ein Wahrnehmen dessen, welche Erfahrungen wir als Erzbistum machen und welche Erfahrungen die Menschen machen. Wir wollen hier im Erzbistum immer wieder darauf achten, dass wir möglichst viel gemeinsam verantworten, immer wieder Schleifen der Partizipation nutzen, damit nicht einfach etwas von oben aufgepfropft wird, sondern damit sich etwas gemeinsam und miteinander entwickelt. Von der Leitungsverantwortung her habe ich als Erzbischof noch einmal einen anderen Blick auf die Bereiche. Die Ehrenamtlichen und die Mitarbeitenden haben vor allem die Sorge für alles vor Ort, lokal und in der Region. Die Bistumsleitung hat die Verantwortung für das Ganze. Dass das alles zu einem Ganzen wird, darin sehe ich auch meine Aufgabe.
Das heißt auch, bestimmte Vorgaben zu machen und zu sagen: „Innerhalb dieses Rahmens ist ganz viel möglich.“ oder „Das oder jenes wird nicht mehr möglich sein, weil wir es uns nicht leisten können oder weil die Gesamtsituation so ist.“ Und dann kann es sein – und das machen wir ja auch –, dass wir uns externe Expertise dazu nehmen, die uns begleitet und unterstützt.
Sie verfügen über Beratungsgremien mit Ehrenamtlichen. Wie wichtig sind diese für Sie?
Das ist ein eigenes Thema im Blick auf „Synodalität“. Derzeit entwickle ich den Diözesanpastoralrat gemeinsam mit den Ehrenamtlichen und der Bistumsleitung weiter hin zu einem Gremium, in dem die wesentlichen pastoralen Strategien für das Erzbistum beraten werden. Die Bistumsleitung entwickelt eine Zielvorstellung und geht dann in die Beratung mit dem Diözesanpastoralrat. Darin sind Ehrenamtliche aus allen Regionen und allen Berufsgruppen vertreten. Mir ist wichtig, gezielt junge Leute anzusprechen. Im Diözesanpastoralrat wird beraten, dann geht es in den Kirchensteuerrat und in den Priesterrat, es geht in die Dechantenkonferenz, es geht wieder in die Bistumsleitung. Die Frage ist also: Wie gestaltet sich ein Weg, der zwar partizipativ ist, sich aber nicht in endlosen Beratungsschleifen verliert? Das ist eine Kunst, darin müssen wir uns üben.
Das bedeutet: Wer heute neu in ein Ehrenamt startet, erlebt eine andere Situation mit mehr Freiheiten als jemand, der schon 20 Jahre lang dabei ist. Wie sehen Sie das?
Ich hoffe, dass das als Chance erlebt und verstanden wird. Natürlich ist das Ehrenamt heute etwas anderes als vor 20 Jahren, denn die seelsorgliche pastorale Situation in der Fläche ist heute auch eine andere als vor 20 Jahren. Das heißt, dass wir wegkommen müssen von einer Versorgungspastoral durch Hauptberufliche hin zu einem lebendigen seelsorglich-pastoral basierten Leben, getragen von möglichst vielen des Gottesvolkes.
Haben Sie Sorgen, wenn Sie an die Pfarrgemeinderats- und Kirchenvorstandswahlen in diesem Jahr denken?
Ja, ich habe Sorge, dass in dieser Unsicherheit viele sagen: „Ich weiß nicht, was auf mich zukommt.“ Ich habe Sorge, dass manche sagen: „Die Prozesse, die auf uns zukommen – wie der Immobilienprozess – erfordern von uns Entscheidungen, die schwer sind. Das kann ich so nicht.“ Und gleichzeitig, das ist meine Erfahrung, ist gerade jetzt die Chance, dass Gremien mitgestalten und mitentscheiden – also Weichen stellen – größer als je zuvor. Das kann eine enorme Motivation sein.
Es gibt aber auch Gremienmitglieder, die eher konservativ sind und weniger Freiheiten wünschen. Wie bekommt man alle unter einen Hut?
Das kann wie die Quadratur des Kreises sein. Wir müssen noch mehr als bisher lernen, mit der Pluralität gut umzugehen, sich gegenseitig als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu erleben. In aller Vielheit sich auch immer wieder des Gemeinsamen versichern. Kirche ist pluraler denn je, dahinter kommen wir nicht zurück. Und das ist gut so! Die Frage ist: Gelingt es uns, die Dialogprozesse und das gemeinsame Entwickeln gut zu begleiten und zu unterstützen? Das ist eine Herausforderung. Unsere Strukturen müssen so sein, dass sie nicht festschreiben, sondern angesichts der Ungewissheit der Zukunft möglichst viel Flexibilität ermöglichen. Ich spreche deshalb gerne von Ermöglichungsstrukturen.
Bei Ihren Reisen kam Ihnen sehr viel Freundlichkeit entgegen. Auf der anderen Seite müssen Sie auch sehr harte Entscheidungen treffen. Ist das für Sie ein Dilemma?
Ich hoffe, auch in Zukunft viel unterwegs, direkt im Gespräch sein zu können. Ich glaube, dass das ein Teil meines Leitungsstils ist. Ich kann Entscheidungen gut treffen, wenn ich weiß, wie sie entstanden sind und wie gut sie abgewogen sind. Derzeit versuche ich zu entwickeln, wie ich nicht die klassische „Visitation“ durchführe – einmal im Jahr ein Dekanat mit allen Details. Denn dann komme ich, so Gott will und ich gesund bleibe, in den nächsten 18 Jahren bestenfalls einmal durch alle Dekanate. Ich möchte Formate entwickeln, dass ich unterjährig möglichst wiederkehrend häufig in den Regionen bin, um dieses Dialogische, dieses Aufnehmen, dieses Hören ganz konkret und gut zu gestalten.
Ich glaube, Kommunikation und Begegnung sowie klare Entscheidung und Führung sind kein Gegensatz. Das eine ist die Voraussetzung für das andere. Wenn ich zu einer guten Meinungsbildung komme, dann kann ich sagen: „So geht’s.“ Oder ich komme in eine Situation, in der ich sage: „Das kann ich nicht verantworten.“ Dann weiß ich aber, dass ich mich vorher auf breiter Basis gemeinsam mit anderen intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt habe. Ich bin kein Freund davon, in einem Kleinstzirkel oder allein am Schreibtisch zu entscheiden. Was viele angeht, muss auch von möglichst vielen in den Blick genommen werden.
Das klingt sehr zeitaufwendig.
Einfach kann jeder (lacht).
Wie werden Schwerpunkte erkannt und gesetzt?
Das ist die Aufgabe einer Bistumsleitung, auch unserer Fachexpertinnen und -experten. Sie arbeiten Themen vor, damit wir in ein Gespräch kommen. Ganz konkret: Es muss klar sein, dass ein künftiger Einsatzplan für das pastorale Personal nicht nur die Entscheidung der Personalabteilung sein kann. Daran hängt die Entwicklung unserer pastoralen Zukunft in der Fläche. Da müssen wir alle miteinbinden. Aber die Vorgaben, wie viel Personal wir zur Verfügung haben, was die Rahmenbedingungen sind, damit Mitarbeitende gut im Team arbeiten können – das ist die Aufgabe der Bistumsleitung. Wir treffen Grundentscheidungen, die dann ins Gespräch gebracht werden und zielorientiert weiterentwickelt werden. Es geht mir um Himmels willen nicht darum: „Es ist gut, dass wir mal drüber reden.“ Zielorientiertheit, klare Kommunikation, dann gemeinsames Entwickeln und Handeln – das sind die grundlegenden Elemente.
Wie kann die Eucharistie zentrales Element des Glaubens sein, wenn a) immer mehr Priester fehlen, b) immer mehr Kirchen geschlossen werden und c) einfach immer weniger Menschen in die Kirchen gehen?
In einer sakramentalen Kirche spielt das Sakrament der Eucharistie natürlich eine wesentliche Rolle. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, dass die Eucharistie Dreh- und Angelpunkt, Kristallisationspunkt oder Höhepunkt der Feier in der Gemeinde ist. Das ist für mich ein Orientierungsmaßstab. Wie müssen wir eigentlich Eucharistie feiern, dass sie auch als Höhepunkt erlebt wird? Was braucht es dafür? Dafür braucht es eine feiernde Gemeinde. Dafür braucht es eine bestimmte Qualität. Es gibt so etwas wie eine liturgische, gottesdienstliche Qualitätssicherung – auch wenn manche den Begriff nicht mögen. Bei zurückgehenden personellen Ressourcen kann allerdings nicht in gleicher, flächendeckender Weise Eucharistie gefeiert werden.
Aber es stellt sich auch die Frage, ob in dieser flächendeckenden Weise die eucharistische Gemeinde überhaupt noch da ist. Es stimmt mich nachdenklich, warum Menschen lieber gar nicht zum Gottesdienst gehen, als irgendwo anders hinzufahren. So wie es in der Diaspora ja eigentlich schon lange ganz üblich ist. Es gibt gute Gründe, warum man das vielleicht nicht kann. Dann muss man aber schauen, wie man es Menschen ermöglicht, zu diesen Kristallisationspunkten hinzukommen. Es bereitet mir zudem Sorgen, wie wir unsere Eucharistiefeier erleben. Es macht doch einen Unterschied, ob ich mit zehn Personen Gottesdienst feiere, vielleicht ohne Orgelspiel, oder ob ich mit einer Gottesdienstgemeinde, mit Ministranten, mit Kantor usw. feiere.
Wir haben ein gutes Angebot, aber die Leute kommen trotzdem nicht: Sehen sie diese Gefahr?
Ja, das ist für mich der nüchterne und ehrliche Blick in die Realität, wie sie nun mal ist. Ich bin der Überzeugung, wenn etwas wirklich gut und wirkungsvoll ist, mit einer entsprechenden Innerlichkeit gefeiert wird, dann hat das seine Anziehungskraft. Ich vertraue darauf, dass die Liturgie ihre eigene Kraft entfaltet und ausstrahlt. Aber wir müssen nüchtern wahrnehmen, dass sich dieser Zugang zur Liturgie und das Gefühl, ob mir etwas fehlt, wenn die Liturgie fehlt, verändert hat. Das ist auch ein Stück unserer Säkularisierung, einer innerkirchlichen Säkularisierung.
Stichwort Finanzen: Wo sehen Sie Schwerpunkte und wo kann aus Ihrer Sicht gespart werden?
Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam Schwerpunkte und Sparpotenziale zu entwickeln. Wir spüren, dass der Mantel zu groß ist. Wir erkennen, dass die Ressourcen in den kommenden Jahren zu wenige sein werden, um in der bisherigen Art und Weise all das weiterzuführen, was wir haben. Wohin wir gehen, das müssen wir gemeinsam entwickeln. Kirche ist das Volk Gottes. Dieser Gedanke muss sich weiter entwickeln. Das heißt für mich ganz konkret, und ich habe das auch im Bistum Mainz erlebt: Wenn wir uns nicht mehr alles leisten können, dann müssen wir in einen Prozess eintreten, und sagen, wo wir pastorale Schwerpunkte sehen, wo weniger Geld hineingehen wird und wo mehr.
Aber das ist doch nicht allein meine Entscheidung. Was wäre das für ein Kirchenbild!? Da sind die Gremien gefordert. Das wird kein Spaziergang. Da kommt es zu Verteilungskämpfen. Mein Grunddiktum ist: Keine Finanzentscheidung ohne eine vorhergehende Pastoralentscheidung. Da muss zuerst eine Bistumsleitung eine Vision entwickeln. Aber diese Vision ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist doch in Dortmund, Herne oder Castrop-Rauxel etwas völlig anderes als das, was ich in Höxter oder im Sauerland brauche.

Wie können Sie als Person solche Entscheidungen vermitteln?
Es gibt den Sachverhalt, dass sich Institutionen und Organisationen – und Kirche ist in diesem Sinne auch Institution und Organisation – anscheinend nur dann grundlegend verändern und entwickeln, wenn die Not groß ist und es nicht mehr anders geht. Das erlebe ich in vielen Bistumsprozessen. Wenn nichts mehr geht, dann kommt etwas in Bewegung. Wollen wir Zukunft gestalten oder nur „getrieben von der Not“ reagieren? Das Rezept ist, möglichst klare Zielvorstellungen zu entwickeln. Und dann: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und in manchen Fällen auch direktiv eingreifen: „Jetzt geht es nicht anders.“ Es gibt Situationen im Erzbistum, da habe ich solche Entscheidungen bereits getroffen.
Auch im Herzen des Erzbistums, in Paderborn, stehen Kirchen wie St. Kilian zur Diskussion. Gibt es für Sie ein Tabu?
Ein einziges Tabu gibt es, wenn Entscheidungen getroffen werden, bei denen offenkundig etwas gegen das tatsächliche Leben vor Ort entschieden wird. Aber eigentlich gibt es kein wirkliches Tabu. Kirche muss nah am Leben der Menschen sein. Man entwickelt vor Ort Konzepte und entscheidet, dieses oder jenes Gebäude können wir nicht mehr weiterführen. Dann möchte ich ein Votum von vor Ort bekommen, das breit gestützt ist. Da gehört für mich zum Beispiel dazu, dass ich zu jedem Immobilienkonzept ein Votum von jungen Menschen haben möchte. Das ist deren Zukunft, über die wir jetzt entscheiden. Wenn ich zu der Überzeugung komme, das Ergebnis ist nicht deckungsgleich mit dem, was an Prozessen vorausgegangen ist, dann ist das ein Tabu. Dann werde ich Einspruch erheben. Es kann aber Situationen geben, in denen alles so verbissen, verkantet und verfahren ist, dass ein Dritter eine Entscheidung treffen muss. Das ist dann die Bistumsleitung. Natürlich gibt es Prioritäten. Dann hat für mich ein Gemeindezentrum eine andere Aufgabe und Rolle als ein sakraler Raum. An einen sakralen, heiligen Raum stelle ich sehr viel höhere Erwartungen und Anforderungen, bis man zu einer Entscheidung kommt.
Die Veröffentlichung der Missbrauchsstudie steht in diesem Jahr an. Welche Szenarien werden bereits durchgespielt? Was erwarten Sie und wie bereiten Sie sich vor?
Es ist eine unabhängige Studie. Wir haben keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir bereiten uns aber darauf vor, sprachfähig und reaktionsfähig auf die Wirklichkeit zu sein, mit der wir konfrontiert werden. Ich glaube, dass wir in eine Situation kommen, in der viele sagen: „Die Studie bestätigt, was in den letzten Jahren bereits deutlich geworden ist.“ Und wir kommen in eine Situation, wo Menschen vielleicht sagen: „Das war mir so gar nicht bewusst.“ Wir bereiten uns darauf vor, Menschen, Gemeinden und Gruppen begleiten zu können. Mir ist es wichtig, dass alle Verantwortlichen in der Seelsorge gut vorbereitet sind. Wie öffnen wir Gesprächsräume? Wie begleite ich Menschen, die kommen und von ihren eigenen Erfahrungen erzählen? Wie gehe ich mit Betroffenen um, die nicht unmittelbar betroffen, aber im Umfeld von Betroffenen sind?
Wichtig aber ist: Die Studie ist nur ein Baustein von Aufarbeitung. Aufarbeitung im Erzbistum fängt mit der Veröffentlichung der Studie nicht erst an. Sie geschieht schon die ganze Zeit. Die Studie ist auch nicht der Abschluss von Aufarbeitung.
Sehen Sie Kirche noch als eine moralische Instanz?
In der gesellschaftlichen Wahrnehmung zeigt sich für mich ein differenziertes Bild. Es ist schon klar, dass wir es als Kirche in Fragen der Sexualität und der Sexualmoral sehr schwer haben. Hier haben wir extrem viel Vertrauen verspielt, und zwar nicht nur durch die Missbrauchskrise. Trotzdem: Kirche wird als moralische Instanz wahrgenommen, gehört und es wird sogar erwartet, dass wir unseren Beitrag leisten. Wir haben die Diskussion über den Lebensschutz. Es wird wahrgenommen, wie wir dazu stehen. Wir werden gehört in Fragen der Personenwürde, etwa am Ende des Lebens. Wir sind eine moralische Instanz in Fragen von Frieden und Gerechtigkeit und unserer ökologischen Verantwortung, Globalisierung und Bildung. Wir formulieren Ansprüche und leben sie auch. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die nicht Mitglied einer Kirche sind. Sie wollen meine Meinung in diesen Fragen hören. Aber klar: Wir haben auch extrem viel Vertrauen verloren.
Brauchen die Menschen noch christliche Hoffnung?
Wir sind eine Stimme von vielen. Das ist unsere Situation in einer pluralen und säkularen Welt. Ein Glaube, der Gott als Person miteinbezieht, ist eine Option von vielen geworden. Glaube ist heute eine bewusste Entscheidung. Aber ich bin überzeugt, dass wir uns dem Wettbewerb stellen können. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben mit dem Evangelium einfach eine starke Botschaft, auch für die Zukunft!